Was ist Biotopschutz: Definition, Maßnahmen und Bedeutung
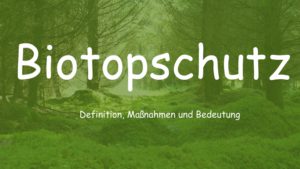
Unter Biotopschutz werden alle Maßnahmen zum Erhalt natürlicher Lebensräume zusammengefasst, mit dem Ziel die dort ansässigen Pflanzen– und Tierarten zu erhalten. Neben dem Arterhalt soll durch den Schutz der Biotope auch die Artenvielfalt gefördert werden.
Inhalt
Was bedeutet Biotopschutz: Definition und Bedeutung
Der Biotopschutz ist Teil des Naturschutzes und ist im Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) gesetzlich verankert. Durch die Maßnahmen, welche gesetzlich abgesichert sind, werden bestimmte Gebiete herausgesucht – um diese als Naturschutzgebiet zu erklären. Diese Gebiete erhalten fortan einen besonderen Schutz, welcher darin besteht, dass die natürliche Beschaffenheit bewahrt wird und die Nutzung der Areale durch den Menschen nur sehr eingeschränkt erfolgen darf.
Die wirtschaftlichen Interessen müssen den Interessen des Naturschutzes weichen, wodurch der Lebensraum für die bedrohten Arten erhalten wird. Durch das Gesetz soll aber nicht die Landschaft erhalten werden, sondern die Population von dort lebenden Tieren und Pflanzen.
Maßnahmen des Biotopschutzes
Typische und symbolträchtige Biotope sind Feuchtbiotope. Im Rahmen des Biotopschutzes werden deshalb regelmäßig neue Teiche angelegt, welche als Lebensraum für Amphibien und Kriechtieren geeignet sind. Aber auch die Tierwelt im Totholz stellt eine Biozönose dar, welche geschützt werden muss. Das Aufhängen von Nistkästen, um die heimischen Singvögel zu schützen ist eine weitere Maßnahme, genauso der Erhalt bestimmter Areale im Wald.
In Nadelwäldern werden außerdem zunehmend Laubbäume gepflanzt, um die biologische Vielfalt im Mischwald zu steigern und weil die Forstwirtschaft erkannt hat, dass Nadelwälder zwar produktiv aber ökologisch nachteilig sind. Die wichtigste Maßnahme bleibt allerdings das Ausweisen eines Naturschutzgebietes.
Formen des Biotopschutzes
Der Biotopschutz erfolgt entweder dadurch, dass Verträge geschlossen werden, um ein Biotop als Naturschutzgebiet zu erklären oder es wird die Rückbildung der Natur in einem Gebiet geschützt. Je nach Strategie unterscheidet man zwischen Vertrags- und Prozessschutz.
Vertragsschutz als Biotopschutz
Beim Vertragsschutz sollen Kulturlandschaften, wie Wiesen oder Weidelandschaften – welche ursprünglich durch Landwirte angelegt worden sind, um ihr Vieh zu ernähren, erhalten bleiben.
Insbesondere artenreiche Landschaften, wie Feuchtwiesen oder Streuobstwiesen stehen im Fokus. Diese Gebiete sind nicht natürlich entstanden und um diese erhalten zu können, bedarf es an Pflege.
Mit den Landnutzern, welche in der Regel Landwirte sind, wird deshalb ein Vertrag geschlossen – welcher beinhaltet, dass diese Gebiete – im Sinne des Naturschutzes – gepflegt und gefördert werden. Dadurch sollen die Wiesen- und Weidenbiotope möglichst naturtreu erhalten bleiben und deren Artenvielfalt gefördert werden.
Prozessschutz als Biotopschutz
Das Gegenstück zum Vertragsschutz – bei dem ein Lebensraum nur durch menschliche Pflege erhalten bleiben kann – ist der Prozessschutz. Diese Strategie verfolgt, dass bestimmte Biotope zu Naturschutzgebieten erklärt werden, dadurch die menschlichen Nutzungsmöglichkeiten derart eingeschränkt werden, so dass sich dort ein Ökosystem etablieren kann.
Das Ziel, den Artenschutz zu fördern, indem eine Landschaft als natürlicher Lebensraum bedrohter Arten erhalten wird – ist dasselbe. Allerdings ist diese Maßnahme, aus Sicht vieler Ökologen und Naturschützer, weitaus sinnvoller – da nicht nur das Biotop geschützt wird, sondern der Lebensraum auch die Möglichkeit zur Selbstregulierung erhält.
Denn dadurch, dass sich ein Ökosystem etabliert, finden wieder diverse Stoffkreisläufe im geschützten Biotop statt. Pflanzen als Primärkonsumenten eines Ökosystems können aus diesen Stoffkreisläufe ihre Nährstoffe beziehen, in ihren Stoffwechsel einschleusen und anorganische Substanzen in organische Stoffe umwandeln. Dadurch werden Tiere angelockt, welche sich von organischen Stoffen der Pflanzen ernähren. Auf die Pflanzenfresser folgen die Fleischfresser, wodurch eine Nahrungskette entsteht – welche langfristig zum Erhalt des Biotops beiträgt.
Durch diese Maßnahme wird ein Biotop nicht nur erhalten, sondern dessen Widerstandsfähigkeit steigt und die Möglichkeit zur Regenerierung ist gegeben, was bei Naturschutzgebieten, welche vertraglich bewirtschaftet werden, nicht der Fall ist.
Biotopschutzgebiete
Im Rahmen des Biotopschutzes nehmen die Naturschutzgebiete die größte Bedeutung ein. Andere Schutzmaßnahmen sind das Errichten von Nationalparks oder die Ausweisung eines Naturdenkmales.
Biotopschutz mittels Naturschutzgebiete
Laut §30 im Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) werden bestimmte Teile der Natur oder der Landschaft – welche eine besondere Bedeutung als Biotop haben – geschützt. Handlungen, welche ein Biotop zerstören oder deren Funktionalität beeinträchtigen, sind verboten. Als Biotop werden im §30 BNatSchG folgende Biotope unter Biotopschutz gestellt (Auszug des Gesetzes).
- natürliche oder naturnahe Bereiche fließender und stehender Binnengewässer einschließlich ihrer Ufer und der dazugehörigen uferbegleitenden natürlichen oder naturnahen Vegetation sowie ihrer natürlichen oder naturnahen Verlandungsbereiche, Altarme und regelmäßig überschwemmten Bereiche,
- Moore, Sümpfe, Röhrichte, Großseggenrieder, seggen- und binsenreiche Nasswiesen, Quellbereiche, Binnenlandsalzstellen,
- offene Binnendünen, offene natürliche Block-, Schutt- und Geröllhalden, Lehm– und Lösswände, Zwergstrauch-, Ginster- und Wacholderheiden, Borstgrasrasen, Trockenrasen, Schwermetallrasen, Wälder und Gebüsche trockenwarmer Standorte,
- Bruch-, Sumpf– und Auenwälder, Schlucht-, Blockhalden- und Hangschuttwälder, subalpine Lärchen– und Lärchen-Arvenwälder,
- offene Felsbildungen, Höhlen sowie naturnahe Stollen, alpine Rasen sowie Schneetälchen und Krummholzgebüsche,
- Fels- und Steilküsten, Küstendünen und Strandwälle, Strandseen, Boddengewässer mit Verlandungsbereichen, Salzwiesen und Wattflächen im Küstenbereich, Seegraswiesen und sonstige marine Makrophytenbestände, Riffe, sublitorale Sandbänke, Schlickgründe mit bohrender Bodenmegafauna sowie artenreiche Kies-, Grobsand- und Schillgründe im Meeres– und Küstenbereich,
- magere Flachland-Mähwiesen und Berg-Mähwiesen nach Anhang I der Richtlinie 92/43/EWG, Streuobstwiesen, Steinriegel und Trockenmauern.
Da die Maßnahmen des Biotopschutzes oft im Konflikt mit der Landschaftsnutzung stehen, gibt es auch Ausnahmen – welche eine Weiternutzung oder Landschaftsgestaltung dennoch ermöglichen. So können bspw. Felsvorsprünge, Steilküsten oder Halden dennoch umgeformt werden, falls sie eine Gefahr für Menschen darstellen. Und so kommt es immer wieder vor, dass sich Gemeinden bzw. Orte über die Bestimmungen des Biotopschutzes hinwegsetzen können, indem sie eine Umgestaltung einer Landschaft bewirken, welche eine Gefahr für den Ort darstellen könnte.
Das öffentliche Interesse an schützenswerten Biotopen muss allerdings geweckt werden, da ansonsten wirtschaftliche oder gemeinnützliche Interessen immer überwiegen werden, was die Durchsetzung von Biotopschutzgebieten erheblich beschwert. Und deshalb wird seit 1988 in Hessen das Biotop des Jahres ausgerufen.
Naturdenkmäler als besonderer Biotopschutz
Der Begriff „Naturdenkmal“ wurde erstmalig durch den deutschen Forschungsreisenden Alexander von Humboldt (1769 – 1859) aufgestellt und bedeutete eine außerordentliche „Naturschöpfung“. Heute werden einzelne Bäume oder ganze Landschaftselemente als Naturdenkmal ausgewiesen und unter Naturschutz gestellt. So kann ein Felsen und dessen Vegetation als Naturdenkmal ausgewiesen werden, genauso wie eine ganze Wiese.
In Deutschland werden Naturdenkmäler durch §28 des Bundesnaturschutzgesetzes geschützt. Dort steht, dass Naturdenkmäler als rechtsverbindliche Einzelschöpfung der Natur zu betrachten sind, welche maximal 5 Hektar groß sein dürfen und einen besonderen Schutz bedürfen. Dieser Schutzanspruch kann sich aufgrund von Seltenheit, Eigenheit oder Schönheit des schützenswerten Objektes ergeben.
Biotopschutz durch das Errichten von Nationalparks
Ein Nationalpark ist ein ausgedehntes Schutzgebiet, welches weitestgehend der Natur überlassen wird und nicht durch menschliche Eingriffe verändert oder erhalten wird. Demnach handelt es sich bei dieser Form des Biotopschutzes um einen Prozessschutz.
Doch anders als in üblichen Naturschutzgebieten wird in Nationalparks eine Form des Tourismus betrieben, um die Menschen auf den Naturschutz aufmerksam zu machen und Gelder einzunehmen, um den Park weiterhin erhalten zu können.
Da aber der Erhalt des Schutzgebietes im Vordergrund steht, werden touristische Aktivitäten weitestgehend eingedämmt und auf das Nötigste beschränkt. Man bezeichnet diese Form des Fremdenverkehrs auch als weichen oder sanften Tourismus.
Anforderungen an Biotopschutzgebiete
Nicht jede Landschaft ist als schützenswertes Biotop geeignet. Denn mitunter kommen in einigen Gebieten keine vom Aussterben bedrohten Arten vor. Und da Artenschutz und Biotopschutz zwei Komplementärstrategien des Naturschutzes sind, sollten beide Ziele bei der Auswahl eines Naturschutzgebietes berücksichtig werden. Deshalb unterscheidet man verschiedene Merkmale, welche ein Biotopschutzgebiet aufweisen sollte – die im Folgenden erklärt werden.
Biotopqualität
Die Qualität eines Biotopes wird daran gemessen, welche Umweltfaktoren dort gegeben sind. Jede Spezies benötigt verschiedene Umweltfaktoren in einem artspezifischen Ausmaß, welche das Schutzgebiet bieten sollte. So benötigen einige Tier- und Pflanzenarten einen bestimmten Salzgehalt in ihrer Umgebung, um ihren Stoffwechsel aufrecht zu halten. Für andere Arten ist dieser Salzgehalt bereits toxisch.
Auch Umgebungstemperatur, Lichteinwirkung, Feuchtigkeit und andere abiotische Umweltfaktoren sind von Bedeutung und müssen je nach Spezies unterschiedlich ausfallen. Nur im sogenannten ökologischen Optimum kann eine Spezies langfristig ihre ökologische Nische bilden und so zur Funktionalität eines Ökosystems beitragen. Das Biotop muss diese Qualitäten bilden, da ansonsten der Artenschutz nicht stattfinden kann.
Biotopgröße
Jedes Biotop muss eine Territorialgröße haben, welche ebenfalls von der ansässigen Tierart abhängig ist. So benötigen Säugetiere ein größeres Territorium als Amphibien oder Kriechtiere. Die Fläche des Biotopschutzgebietes richtet sich also daran aus, welche Tierarten man im Biotop vorrangig schützen will.
Bereits bestehende Lebensgemeinschaft im Biotopschutzgebiet
Jedes Biotop bietet bereits eine Lebensgemeinschaft an. Selbst wenn es im auserwählten Schutzgebiet nur wenig größere Tierarten gibt, existieren dort dennoch Pflanzen, Bakterien und andere Mikroorganismen. Auch Insekten, Weichtiere und andere Wirbellose sind meistens schon vertreten. Und diese Organismen reagieren darauf, wenn neue Sicherungsmaßnahmen ergriffen werden, wohlmöglich werden diese vertrieben oder stark dezimiert.
Auch die Ausweisung eines Schutzgebietes, um dort eine bestimmte Tierart ansiedeln zu lassen – hat Folgen. Denn jede Spezies bildet eine eigene ökologische Nische und kann in Nischenkonkurrenz zu anderen Arten treten, wodurch diese verdrängt werden könnten. Neben Nahrungskonkurrenz muss auch die Stellung in der Nahrungspyramide passen, da bspw. das Ansiedeln von Prädatoren eine nachteilige Wirkung auf die Pflanzenfresser haben könnte, welche man vielleicht ebenfalls zu schützen versucht.
Kollidierende Nutzung im Biotopschutzgebiet
Erklärt man bspw. einen Teich oder See zum Schutzgebiet, muss klar sein – dass dieser von der Fischerei befreit ist. Das Aufziehen und Züchten von Speisefischen, sowie das Angeln von Fischen kann in diesem Gebiet nicht mehr stattfinden.
Genauso kann eine Wiese, die als Schutzgebiet ausgewiesen wurde, nicht mehr als Nahrungsquelle für Nutztiere betrachtet werden. Ein Waldgebiet, welches unter Naturschutz gestellt wird, ist für die Forstwirtschaft nicht mehr zugänglich. Demnach dürfen dort keine neuen Bäume gepflanzt, noch alte Bäume abgeholzt werden.
Vernetzbarkeit mit anderen Biotopen
Eine weitere Anforderung des Naturschutzes ist, dass sich Teilbiotopen zu einem großen Netz verbinden lassen sollen. So sorgen bspw. Krötentunnel und Wildbrücken dafür, dass Kröten bei ihrer Wanderung von einem Biotop zum nächsten gelangen.
Diese Biotopverbindung soll dafür sorgen, dass ein permanenter Individuenaustausch stattfinden kann, wodurch die genetische Vielfalt der Arten wächst. Denn Artenschutz setzt voraus, dass ein mindestgroßer Genpool innerhalb einer Art besteht. Durch diese breit aufgestellte Genvielfalt können die Arten besser auf veränderte Umweltbedingungen reagieren, was das Überleben der Art langfristig sichert. Die Vernetzung der Biotope soll diese Form der Biodiversität gewährleisten.
Aber die Vernetzung ist an bestimmte Voraussetzungen geknüpft. So muss bspw. die Krötenwanderung von einem Biotop zum anderen über eine Nichtschutzgebiet stattfinden können. Dieses Gebiet muss barrierefrei gestaltet werden, so dass es für die Kröten überwindbar ist.
Die Biotopvernetzung bzw. Biotopverbund stellen eine langfristige Strategie zum Arterhalt dar, werden aber bei der Auswahl eines Schutzgebietes als zusätzlicher Aspekt herangezogen.
Kritik am Biotopschutz
Kritik am Biotopschutz äußern Teile der Gesellschaft, aber auch Wissenschaftler kritisieren deren Umsetzung.
Der Naturschutzbiologe Reinhard Piechocki kritisiert, dass der Prozessschutz – also der Schutz natürlicher Prozesse – durch eine menschliche Vorstellung über die Wildnis dominiert wird. Dadurch werden bestimmte Schutzmaßnahmen zum Ausbau und Erhalt dieser Wildnisvorstellung getroffen, welche nicht zielführend seien. Piechocki wirft den Verantwortlich vor, dass der Biotopschutz nicht dem Schutz der Natur diene, sondern lediglich einer idealtypischen Natur – die man von romantischen Naturbildern kennt.
Der Biotopschutz ist durch das Bundesnaturschutzgesetz rechtlich legitimiert. Dies stellt enorme Anforderungen an Landschaftsgebiete, welche durch das Gesetz als Schutzgebiet erklärt worden. Diese Landschaftspflege und Erhaltung setzt einen hohen Bedarf an finanziellen Mitteln voraus, welcher durch die Allgemeinheit – in Form von Steuern – bezahlt wird. Nicht jeder Bürger eines Staates sieht ein, dass die Natur bzw. bestimmte Naturgebiete durch öffentliche Gelder geschützt werden sollten.
Naturwälder, im Sinne von Urwald, existieren in Deutschland nicht, da während der Menschheitsgeschichte das Holz der Wälder genutzt wurde, um Schiffe, Möbel und Werkzeuge zu bauen. Anstelle einer Naturlandschaft trat ein Forstgebiet, welches als Kulturlandschaft heute erhalten bleiben soll. Allerdings werden auch die Kulturlandschaften durch Forstwirtschaft, Landwirtschaft, Siedlungsbau und Holzwirtschaft bedroht. Naturschützer können Schutzgebiete nur durch politische Instrumente erhalten und diese Gebiete der öffentlichen Nutzung entziehen.
Über den Autor
